Zwischen Himmel und Erde
Die Darstellung der Archivmeldungen wird kontinuierlich verbessert. Sollten Sie Fehler bemerken, kontaktieren Sie uns gerne über support@systeme-e.de
Gott gleich sein zu wollen ist wohl eine der größten Versuchungen des Glaubens. Menschen, die ihr unterliegen, reden von Gott, als gehöre der ihnen. Sie vertreten die eigenen Überzeugungen mit einem Absolutheitsanspruch, der keinen Widerspruch duldet. Sie machen sich Gott dienstbar für das eigene Machtgebaren, ja, oft scheuen sie sich nicht einmal, im Namen Gottes Kriege zu führen gegen die, die anders oder gar nicht glauben.
Jeder menschliche Absolutheits- oder Allmachtsanspruch aber ist eine Gott geraubte Macht, die unmenschlich macht. Es ist uns nicht gegeben, allmächtig oder allwissend zu sein. Wohl darum erscheint es dem Verfasser des Philipper-Hymnus so bemerkenswert, dass Jesus, der Gottessohn, es gerade nicht als einen Raub nahm, Gott gleich zu sein.
Als er sich auf den Weg zur Erde machte, um Mensch zu werden, ließ er alle Göttlichkeit hinter sich. Er schlüpfte in die Haut des Menschen, ganz und gar, ohne doppelten Boden, ohne Notausgang oder Hintertür.
Jesus erniedrigte sich, er lieferte sich aus. Dem Menschsein. Und den Menschen. Geboren werden, über die Erde gehen, vergänglich sein. Weinen und klagen, feiern und glücklich sein. Verstanden werden und verspottet. Freunde finden, von Gegnern bespuckt werden. Jubelnd willkommen geheißen und später mit Dornen bekrönt.
Und doch war und blieb er ein besonderer Mensch. Was macht die Gottgleichheit aus, von der es heißt, er habe sie nicht als Raub betrachtet?
Ich stelle mir vor, dass Jesus sich vollkommen in Gott eingefühlt hat, als käme er ganz aus dessen Herzen. Er hat ihn bis auf den Grund verstanden:
Gott ist so frei, die Trennlinie zwischen Himmel und Erde behutsam fortzuwischen. Er ist so verwegen, die Perspektive zu wechseln und sich einzufühlen in die Menschen. Und er ist so beherzt, seine Allmacht nicht mit Gewalt durchzusetzen, sondern sie der Liebe anzuvertrauen. Darum kommt er nicht als gewaltiger Herrscher daher, sondern als Kind: angewiesen auf andere Menschen, die ihn unterstützen, damit er groß werden kann.
Durch Jesus erfahren wir: Gott verringert das Machtgefälle zwischen sich und der Welt nicht nur, er kehrt es sogar um. Verletzbar wird er und bedürftig. Ein Säugling, ungeeignet als Projektionsfigur für Allmachtsphantasien und Größenwahn.
Gott zieht das Wagnis den unumstößlichen Gewissheiten vor. Er wählt die Menschlichkeit als göttliches Antlitz. An jedem Morgen zittert er sich neu ins Leben.
Was bedeutet es heute, Gott nicht zu berauben, sondern seine Freiheit zu achten? Wie könnte es aussehen, Jesus zu folgen?
Es könnte heißen, auf triumphalistische Rede zu verzichten, die allzu vollmundig und selbstgewiss vom großen und allmächtigen Gott spricht. Es könnte bedeuten, die Insignien der Macht aus der Hand zu geben: Geld, Einfluss und Ruhm zu teilen und für andere einzusetzen. Es könnte sich zeigen in der Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln und sich einzufühlen in Geflüchtete und Unterdrückte und sich mit ihnen zu solidarisieren.
Jesus zu folgen ist riskant. Es bedeutet, nicht zu wissen, wie es ausgeht. Einen Vertrauensvorschuss in die Welt schicken. Lieben, ohne zu fragen, ob es sich lohnt. Menschlichkeit leben, denn sie ist Gottes irdisches Antlitz.
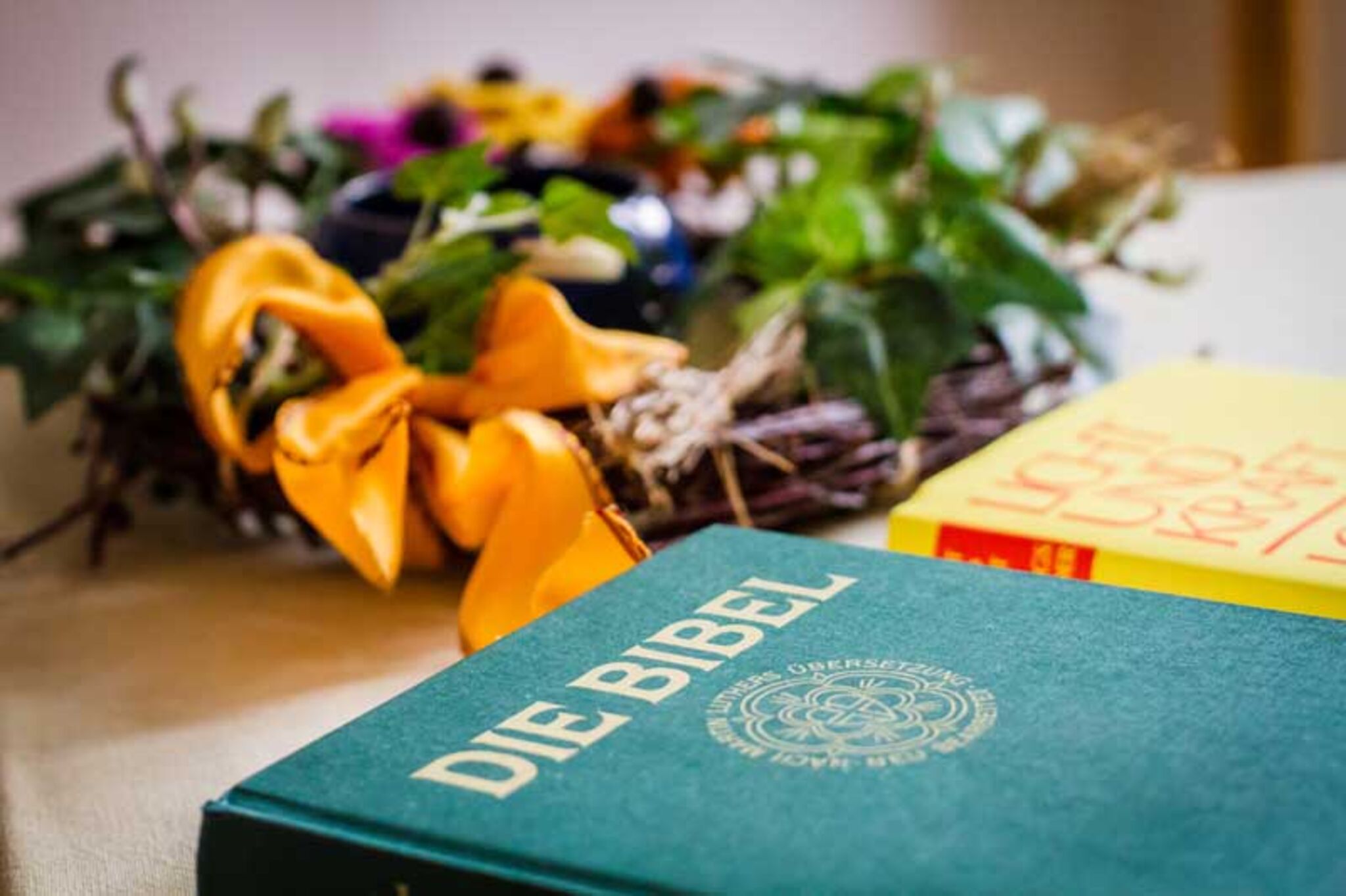

Tina Wilms Bild: privat
